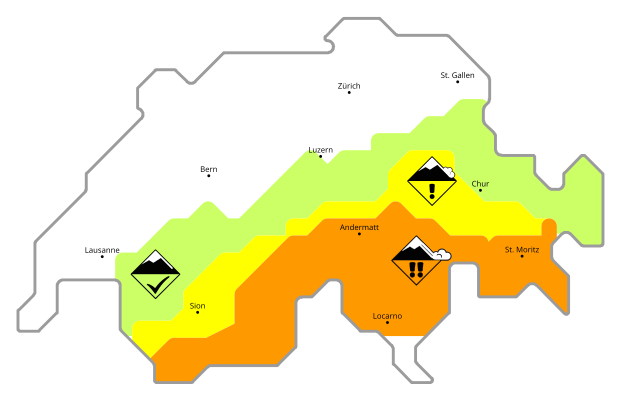Publikationsdatenbank DORA
DORA ist die digitale Publikationsdatenbank für alle wissenschaftlichen Artikel und anderen Publikationen mit WSL-Beteiligung.
Bestellen von WSL Publikationen
Alle unsere Reihen stehen als PDF zum Download bereit. Einzelne gedruckte WSL Berichte können gratis bestellt werden, andere sind nur als Download verfügbar. Einzelne Sonderformate bieten wir auch in gedruckter Form in unserem E-Shop an.
Bitte beachten Sie, dass bei Merkblättern die Bestellmenge auf 30 Exemplare limitiert ist. Allfällige Zollkosten beim Versand ins Ausland müssen vom Empfänger übernommen. werden. Grössere Bestellungen sind nur auf Anfrage und gegen Verrechnung eines Unkostenbeitrages möglich.
Bestellungen bitte an: e-shop(at)wsl.ch
Kontakt
Publikationen (Web und Print)
Sandra Gurzeler
Eidg. Forschungsanstalt WSL
Zürcherstrasse 111
CH-8903 Birmensdorf
sandra.gurzeler(at)wsl.ch
Merkblatt für die Praxis
Martin Moritzi
Eidg. Forschungsanstalt WSL
Zürcherstrasse 111
CH-8903 Birmensdorf
martin.moritzi(at)wsl.ch
www.wsl.ch/merkblatt
Newsletter
Der WSL-Newsletter informiert ungefähr zweimonatlich über Forschung, Publikationen und weitere Neuigkeiten von WSL und SLF.